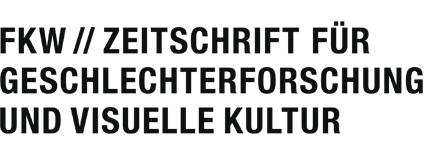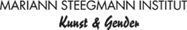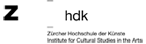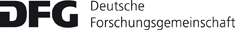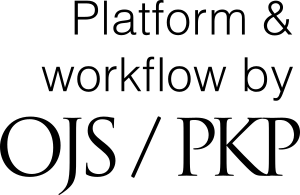Über die Zeitschrift
Konzept
FKW // Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur analysiert visuelle Repräsentationen und Diskurse in ihrer gesellschaftlichen und geschlechterpolitischen Bedeutung. So verbindet FKW kunst- und kulturtheoretische, bild- und medienwissenschaftliche, genderspezifische, politische und methodische Fragestellungen zu einer kritischen Kulturgeschichte des Visuellen. Fragen nach Konstruktionen im Feld der visuellen Kultur, nach Ein- und Ausschlussmechanismen, symptomatischen Subjektentwürfen wie unreflektierten Objektivierungen stehen im Vordergrund des repräsentationskritischen Interesses. Aus einer Perspektive heraus, die Wissen und Verstehen als dynamische, immer auch in Veränderung befindliche Prozesse begreift, sieht sich FKW als eine Plattform für konstruktive Auseinandersetzung und Diskussion, die dazu Denkanstöße geben und Wege des Umdenkens kritisch begleiten will.
Seit ihrer Gründung erscheint FKW halbjährlich. Jede Ausgabe gliedert sich in einen Themenschwerpunkt (Rubrik Beiträge), Rezensionsessays (Rubrik Rezensionen) sowie eine kommentierte Künstlerinnenedition (Rubrik Edition). Mit den jeweiligen Schwerpunkten greift FKW aktuelle Debatten in Wissenschaft und Kultur auf, gestaltet sie mit und setzt auch neue Themen. Die Rezensionen reagieren auf aktuelle Publikationen, Tagungen und Ausstellungen. Unter der Rubrik „Edition“ werden Arbeiten zeitgenössischer Künstlerinnen (und bisweilen Künstler) vorgestellt, wobei die limitierten Editionsauflagen käuflich erworben werden können. Das Anliegen von FKW ist hier, die Position geschlechterkritisch arbeitender Künstlerinnen zu stärken und forschende Tätigkeit mit künstlerischen Formaten und Diskursen zu verbinden. Rezensionen und künstlerische Edition werden möglichst auf den thematischen Schwerpunkt hin abgestimmt. Die Heftthemen können durch thematisch freie Einzelbeiträge, die sich durch ihre aktuelle Relevanz für die Geschlechterforschung im Bereich der visuellen Kultur auszeichnen, partiell ergänzt werden.
Peer-Review-Vorgang
Für die Herausgabe der einzelnen Hefte zeichnen jeweils ein bis drei Mitglieder des Redaktionsteams verantwortlich. Bitte liefern Sie Ihren Beitrag bei der Herausgeberin, mit der Sie auch seinen Umfang sowie inhaltliche Einzelheiten abgesprochen haben, pünktlich zum vereinbarten Zeitpunkt ab. In unserem Peer Review Verfahren erfolgt die Begutachtung der Beiträge zunächst durch die verantwortliche Herausgeberin bzw. die verantwortlichen Herausgeberinnen, die sie dann an die Expertinnen des Redaktionsteams weiterleiten. Bei Bedarf werden der wissenschaftliche Beirat und/oder externe Wissenschaftler_innen hinzugezogen. Über eventuelle Vorschläge für Veränderungen informieren wir Sie rechtzeitig.
Open-Access-Richtlinie
FKW // Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur ist seit 2013 eine Open-Access-Zeitschrift. Alle Beiträge können kostenlos und ohne Hürden gelesen und heruntergeladen werden.
Ab 2017 erscheinen alle Texte von FKW // Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur unter der Lizenz CC-BY-NC-ND Lizenz 4.0 International (Creative Commons, Namensnennung, Nicht Kommerziell, Keine Bearbeitungen 4.0 International). Der Lizenzvertrag ist abrufbar unter: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.de, eine allgemein verständliche Fassung unter: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
Von 2013 bis 2016 sind alle Texte von FKW // Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur unter der Digital Peer Publishing Lizenz (DPPL) erschienen. Der Lizenztext ist im Internet abrufbar unter der Adresse: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0009-dppl-v2-de3.
Autorinnen von Artikeln erschienen vor 2013
Wir freuen uns, mit dem neuen Format von FKW die elektronische Archivierung und öffentliche Zugänglichmachung von bereits erschienenen Heften und Beiträgen zu realisieren. Auch die vergriffenen Hefte stehen dadurch zum Lesen und Herunterladen zur Verfügung. Wir haben uns sehr bemüht, sämtliche Autor_innen anzuschreiben und um ihre Unterstützung bei der Erstellung des FKW-Online-Archivs zu bitten. Leider ist es uns nicht in allen Fällen gelungen, eine aktuelle Adresse ausfindig zu machen. Falls Sie als Autor_in nicht einverstanden sind mit der Online-Veröffentlichung Ihres Textes, bitten wir, uns zu kontaktieren. Wir werden dann umgehend den Text aus dem Netz nehmen.
Geschichte
FKW // Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur wurde im Anschluss an die 3. Kunsthistorikerinnen-Tagung 1986 in Wien unter dem Titel Frauen Kunst Wissenschaft gegründet. Die Gründerinnen waren Dr. Bettina Brand-Claussen, Sigrid Gensichen, Doris Noell-Rumpeltes, Dr. Hannelore Paflik-Huber, Dr. Christa Schulte und Prof. Dr. Katharina Sykora. Der wissenschaftlichen und wissenschaftskritischen Auseinandersetzung mit genusspezifischen Fragestellungen im deutschsprachigen Raum – Deutschland, Österreich und Schweiz – sollte ein Diskussionsforum bereitgestellt und zur internationalen Vernetzung feministischer Kulturinitiativen beigetragen werden. An diese Zielsetzung knüpft die seit 2007 als FKW // Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur weitergeführte Zeitschrift an, die nach wie vor das einzige Publikationsorgan für Geschlechterforschung und visuelle Kultur im deutschsprachigen Raum ist: Die Redakteurinnen der Zeitschrift sehen ihre Aufgabe darin, die vielfältigen theoretischen und methodischen Positionen des kritischen Diskurses um Geschlecht als Analysekategorie in Form von Themenheften zu bündeln und den Argumenten wie Akteurinnen und Akteuren zu mehr Aufmerksamkeit in der Fachöffentlichkeit zu verhelfen. Mit Ausgabe Nr. 54 (2013) wird die Druckausgabe des Periodikums durch die digitale Open-Access-Veröffentlichung ersetzt, so dass FKW ihre Rolle als zentrales Forum einer explizit gender-orientierten bild-, kunst- und kulturwissenschaftlichen Forschung (im deutschsprachigen Raum) und die damit verbundenen Aufgaben auch weiterhin wahrnehmen sowie den Adressatenkreis ausbauen kann.
Sponsors
Das Redaktionsteam von FKW dankt den Institutionen, die die Zeitschrift finanziell unterstützen. Besonders dem Mariann Steegmann Institut (Bremen) und dem Institute for Cultural Studies (Zürich), die sowohl den Trägerverein als auch die Herausgabe der einzelnen Ausgaben unterstützen. Die DFG förderte großzügig speziell die Transformation der Zeitschrift in ein open access journal.
- Mariann Steegmann Institut. Kunst & Gender
- Institute for Cultural Studies in the Arts der Zürcher Hochschule der Künste
- Deutsche Forschungsgemeinschaft
Erklärung zur Barrierefreiheit
Die Redaktion von FKW // Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur unterstützt durch das Team "Open Access und wissenschaftliches Publizieren" der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin ist bemüht, das Web-Angebot der Zeitschrift barrierefrei zugänglich zu machen. Das Angebot soll wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und robust gestaltet werden. Ohne öffentliche Stelle zu sein, bezieht sich die Redaktion, in Bremen ansässig, dabei auf das Bremische Behindertengleichstellungsgesetz (BremBGG), in Kraft getreten am 1. 1. 2020, zuletzt geändert am 20. 10. 2020 (Abschnitt 3: Barrierefreie Informationstechnik öffentlicher Stellen) zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parlaments und des Rates. Die technischen Anforderungen zur Barrierefreiheit ergeben sich aus der aktuellen Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV).
Die Redaktion dokumentiert hier den aktuellen Stand des auf Basis der Content Management Software Open Journals Systems (OJS) des Softwareherstellers Public Knowledge Project (PKP) in der Version 3.1.2.4 an der Universitätsbibliothek der Freien Universität gehosteten Web-Angebots unter der Domain https://www.fkw-journal.de/index.php/fkw
Diese Erklärung basiert auf einer gemäß unserem Kenntnisstand vorgenommenen Selbstbewertung sowie auf Informationen des Softwareherstellers PKP:
FKW // Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur ist als Web-Angebot barrierefrei, soweit uns (als Redaktion eines wissenschaftlichen Journals) dies momentan möglich erscheint. Das Angebot ist aber (noch) nicht komplett mit den technischen Anforderungen gemäß der Verordnung BITV 2.0 vereinbar.
Die Barrierefreiheit des oben aufgeführten Web-Angebots wird grundlegend durch die Vorarbeiten des Softwarehersteller PKP bestimmt. PKP bemüht sich im Rahmen seiner Accessibility Interest Group kontinuierlich die Barrierefreiheit seiner Produkte zu verbessern. Dementsprechend sind neuere Softwareversionen in der Regel barrierefreier als ältere Softwareversionen. Die Versionen ab 3.x von OJS und OMP wurden bereits durch PKP einem externen Accessibility Audit unterzogen und werden kontinuierlich verbessert, basierend auf den daraus gewonnenen Erkenntnissen. Anpassungen des Designs des Web-Angebots durch die Redaktionen können zu Änderungen im Grad der Barrierefreiheit führen.
Die nachfolgend aufgeführten Inhalte sind nur eingeschränkt barrierefrei zugänglich:
- Die Bedienbarkeit der Websites mittels Tastatur ist gegeben, jedoch ist der Tastaturfokus nicht durchgängig sichtbar. An einigen Stellen besteht zudem Optimierungsbedarf bei der Reihenfolge der Tabulatorschritte.
- Alternativtexte sind nicht verfügbar.
- Der Farbkontrast kann in bestimmten Konstellationen etwas niedriger als der Standard der Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)
- Was Größe und Qualität der Abbildungen betrifft, haben wir Bildrechte zu wahren. Dies mag mitunter unbefriedigend sein.
- PDF-Dateien, veröffentlicht vor 2013, Ausgabe Nr. 54, sind nicht barrierefrei.
Eine Verbesserung der Zugänglichkeit ist in unserem Interesse.
Diese Erklärung wurde am 4. August 2022 erstellt. Zuletzt überprüft am 4. August 2022.
Die Inhalte des Internetauftritts sollen für Menschen mit Behinderungen sowie für Menschen mit temporären oder situationsbedingten Einschränkungen gleichermaßen nutzbar sein. Sollten Sie auf unseren Webseiten auf Mängel aufmerksam werden, freuen wir uns über Ihren Hinweis.
Nutzen Sie bitte die E-Mail-Adresse info@fkw-journal.de oder senden Sie uns eine Nachricht mit einer Beschreibung des Problems unter Angabe der vollständigen Webadresse an die Postanschrift der Redaktion:
FKW // Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur
c/o Mariann Steegmann Institut. Kunst und Gender
Universität Bremen
FVG M1060/1061
Celsiusstr. 2
28359 Bremen
Deutschland
Wir sind bemüht, Ihr Schreiben so schnell als möglich zu beantworten und die Vorschläge zu prüfen bzw. umzusetzen. Falls unsere Antwort nicht zufriedenstellend sein sollte, können Sie sich an folgende Stellen wenden. Bitte beachten Sie aber, dass ein eigentliches Durchsetzungsverfahren für „öffentliche Stellen“ vorgesehen ist:
Informationen zur Zentralstelle für barrierefreie Informationstechnik der Freien Hansestadt Bremen:
Hier der link zum Kontaktformular: